Bauchspeicheldrüsenschwäche beim Hund
- Olivier Rainer
- 24. Apr. 2024
- 10 Min. Lesezeit
Wenn Du auf dieser Seite gelandet bist, heißt es vermutlich, dass bei deinem Hund eine Bauchspeicheldrüsenschwäche oder eine Bauchspeicheldrüsenentzündung vorliegt.
Ich gehe davon aus, dass Du Tierärztlich betreut werden. Unsere Informationen dienen der Unterstützung, dem Verständnis, der Information und sind keines Falls eine (Fern-) Diagnose.
Inhalt
1. Funktionelle Anatomie der Bauchspeicheldrüse (kurz)
Die Bauchspeicheldrüse (Pankreas) besteht aus einem endokrinen und einem exokrinen Teil.
Der endokrine Teil produziert unter anderem die Hormone Insulin und Glucagon, der exokrine Teil Verdauungsenzyme und andere Proteine, die mit dem alkalischen Pankreassekret in den Dünndarm abgegeben werden.
Der exokrine Teil ist ähnlich wie die Speicheldrüse in mehrere 1000 Läppchen gegliedert, die jeweils mehrere Drüsenstücke (Azini) und -gänge enthalten. Diese werden von den Azinuszellen umgeben, die das Pankreassekret produzieren, das über den Ductus pancreaticus ins Duodenum gelangt.

2. Was macht die Bauchspeicheldrüse?
Die Bauchspeicheldrüse (Pankreas) bildet den sogenannten Pankreassaft/sekret und gibt ihn kurz hinter dem Magen in den Dünndarm (Zwölffinderdarm) ab.
Schon der Geruch einer Mahlzeit lässt nicht nur das Wasser im Mund zusammenlaufen, sondern auch den Pankreassaft im Zwölffingerdarm (Duodenum). So bringt es ein 10 kg schwerer Hund täglich auf bis zu einen 1/2 Liter dieses wichtigen Safts (beim Menschen sind es etwa 1,5 l).
Der Pankreassaft neutralisiert die Magensäure, wenn der sehr saure Mageninhalt (1-2 phWert) in den Dünndarm gelangt. Der Pankreassaft enthält deshalb eine hohe Konzentration an Bicarbonat, das zusammen mit alkalischen Sekreten der Leber und des Darms die Säuren neutralisiert. Im sauren Milieu könnten die Enzyme nicht arbeiten. So schafft er optimale Arbeitsbedingungen für die von der Bauchspeicheldrüse gebildeten Verdauungsenzyme, die die Nährstoffe aus dem Futter aufspalten:
Peptidasen zur Verdauung von Eiweißen
Amylase zur Verdauung von Kohlenhydraten
Lipasen zur Verdauung von Fetten
Nukleasen zur Verdauung von DNA und RNA
Für die, die es ganz genau wissen wollen 😊
Proteine im Pankreassekret |
| |
Name | Funktion | Substrate |
Trypsin(ogen)e 1, 2, 3 | Hydrolyse von Arg-, Lys-Peptidbindungen | basische Peptidbindungen |
Chymotrypsin(ogen) | Hydrolyse von Phe-, Tyr-, Trp-Peptidbindungen | aromatische Peptidbindungen |
(Pro)Elastasen 1, 2 | Hydrolyse aliphatischer Peptidbindungen | Elastin |
(Pro)Carboxypeptidase A1, A2 | C-terminale Hydrolyse von Phe-, Tyr-, Trp-Peptidbindungen |
|
(Pro)Carboxypeptidase B1, B2 | C-terminale Hydrolyse von Arg-, Lys-Peptidbindungen |
|
(Pro)Aminopeptidase | N-terminale Hydrolyse von Peptidbindungen |
|
kohlenhydratspaltende Enzyme |
|
|
α-Amylase | Hydrolyse α-1,4-glykosidischer Bindungen der Stärke | Stärke, Glykogen |
lipolytisch wirkende Enzyme |
|
|
Carboxylesterlipase | Hydrolyse aller Esterverbindungen | Cholesterinester |
Pankreaslipase | Hydrolyse von C1- und C3-Glycerinesterbindungen | Triacylglycerine |
(Pro)Phospholipase A2 | Hydrolyse von 1,2-Diacylglycerophosphocholin an Position 2 | Phospholipide |
Cholesterinesterase | Hydrolyse von Cholesterinestern | Cholesterinester |
nucleolytisch wirkende Enzyme |
|
|
DNasen | DNA-Hydrolyse | DNA |
RNAsen | RNA-Hydrolyse | RNA |
Sonstige |
|
|
Trypsininhibitoren | Schutz vor Selbstverdau | – |
Glykoprotein 2 (GP2) | Re-Endozytose, verhindert Pankreassteinbildung (?) | – |
Lithostatin | Verhindert Pankreassteinbildung (?) | – |
Pankreatitis-assoziiertes Protein | Bakteriostatisch (?) | – |
Hier sieht man auch wie Komplex unsere Organe und unser Organismus arbeitet.
Die Menge der Enzyme im Pankreassaft kann sich an die Art des Futters anpassen.
So wird zum Beispiel bei kohlenhydratreicher Fütterung mehr Amylase ausgeschüttet.
Erst nach der Aufspaltung durch die Verdauungsenzyme können die Nährstoffe aus dem Futter durch die Darmwand ins Blut gelangen und dem Körper als Energielieferanten dienen.
Produziert die Bauchspeicheldrüse aufgrund einer Unterfunktion zu wenig eigene Verdauungsenzyme, müssen diese durch spezielle Enzympräparate ersetzt werden, damit die Verdauung funktioniert (siehe Empfehlung unten).
Entzündungen der Bauchspeicheldrüse, treten bei Hund und Katze immer häufiger auf.
Die Krankheit, die akut und chronisch verlaufen kann, ist äußerst ernst zu nehmen und muss meist stationär behandelt werden. Abgesehen davon, dass die Tiere unter starken Schmerzen leiden, hat das Pankreas, das im Oberbauch zwischen Magen und Dünndarm liegt, u. a. zwei lebenswichtige Aufgaben im Körper.
Bei mildem Verlauf kann eine akute Pankreatitis wieder ausheilen, bei der chronischen Form nehmen die Organschäden im Laufe der Zeit zu. In schweren Fällen kann die Entzündung sogar mit Organversagen tödlich enden.
3. Wodurch entsteht eine Bauchspeicheldrüsenschwäche?
Eine erbliche, sogenannte juvenile Form der Bauchspeicheldrüsenschwäche tritt bei Junghunden auf. Sie werden zwar in der Regel mit einer funktionierenden Bauchspeicheldrüse geboren, doch beginnt diese bereits im Welpenalter zu schrumpfen (Pankreasatrophie), sodass viele Junghunde im Alter von 6 bis 18 Monaten erste Symptome entwickeln.
Manche aber auch erst später. Man vermutet, dass eine Autoimmunreaktion diese Schrumpfung verursacht. Großwüchsige Hunde wie z.B. Deutsche Schäferhunde sind besonders häufig betroffen, ebenso kurzhaarige Collies.
Die Bauchspeicheldrüsenschwäche kann jedoch auch Folge einer Bauchspeichel-drüsenentzündung (Pankreatitis) sein, wenn durch die Entzündung so viel Gewebe zerstört wird, dass nicht mehr genügend enzymproduzierende Zellen vorhanden sind, um den Bedarf an Verdauungsenzymen zu decken.
Dass eine einmalige akute Entzündung so viel Gewebe zerstört, ist äußerst selten der Fall. Meist ist die Unterfunktion Folge einer chronischen Pankreatitis, deren wiederkehrende Entzündungsschübe auch unbemerkt bleiben können.
Tumoren verursachen nur selten eine Bauchspeicheldrüsenschwäche und bei Tumorpatienten stehen normalerweise andere Symptome im Vordergrund als die der Pankreasinsuffizienz.
Obwohl sich die Aufgabe der Bauchspeicheldrüse simpel anhört, ist sie in Wahrheit nicht ungefährlich für das Organ selbst, da es in ständiger Gefahr schwebt, sich selbst zu verdauen. Damit dies nicht passiert, gibt es eine Reihe von Schutzmechanismen, die dafür sorgen, dass die Enzyme erst im Dünndarm ihre Arbeit beginnen.
Versagen diese Schutzmechanismen, kommt es zu einer schmerzhaften Bauchspeicheldrüsenentzündung (Pankreatitis).

Eingebettet in das Drüsengewebe des Pankreas liegen
die nach ihrem Entdecker benannten
Langerhansschen Inseln. Die Inselzellen produzieren hauptsächlich die den Blutzuckerspiegel regulierenden Hormone Insulin und Glucagon, aber auch Hormone, die z.B. die Ausschüttung von Pankreassaft regulieren und ein Sättigungsgefühl erzeugen.
4. Was löst eine Pankreatitis beim Hund aus?
Eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse kann viele verschiedene Auslöser haben. In den meisten Fällen bleibt die eigentliche Ursache unklar. Einige Rassen wie etwa Boxer, Zwergpudel, Minischnauzer, Cocker Spaniel und Collies haben eine gewisse Veranlagung für diese Erkrankung. Darüber hinaus tritt Pankreatitis häufiger bei Hündinnen und bei älteren Tieren auf.
Unseren Beobachtungen zufolge gibt es einige Faktoren, die das Risiko für eine Pankreatitis erhöhen können.
Dazu gehören:
Mangelhafte Ernährung (nicht bedarfsdeckende Miconährstoffversorgung)
Hoher Fett- und Kalziumgehalt im Blut
Bestimmte Medikamente
Infektionen
Vergiftungen
Gallenwegerkrankungen oder andere Grunderkrankungen (z. B. Diabetes mellitus, Schilddrüsenunterfunktion, Morbus Cushing)
Andauernder Stress
Chronische Magen-Darm-Erkrankungen
Beschädigung der Bauchspeicheldrüse durch ein Trauma oder während einer Bauch-OP
Übergewicht, das durch eine fetthaltige (insbesondere stark erhitzte Fette, die Entzündungen begünstigen)(Transfette) und kohlenhydratreiche Fütterung verursacht wurde

5. Aus ganzheitlicher Sicht kann Pankreatitis eine Folge von Schäden im Magen-Darm-System sein.
Langjährige tierärztliche Erfahrungen zeigen, dass die Ursache für eine Pankreatitis bei Hunden oft schon im Jugendalter gelegt wird:
Dies beginnt meist mit einer mangelhaften Entwicklung der Magen-Darm-Schutzfunktion und gleichzeitigen Schäden an der Darmflora, kann dann in eine chronische Übersäuerung und Belastung des Blutes übergehen, bis hin zu einer Verschlackung der Milz und Leber und somit einer mangelnden Entgiftung über das Lymphsystem.
In diesem Fall kann es passieren, dass die Milz und Nieren den pH-Wert im Blut nicht mehr aufrechterhalten können. Als häufige Folge verklumpt das Blut und durch die geschwächte Magenwand dringen immer mehr Radikale in das ohnehin schon verdickte Blut. Üblicherweise passen durch ein Blutgefäß der Bauchspeicheldrüse maximal drei rote Blutkörperchen nebeneinander. Verklumptes Blut dagegen kann das 50-fache Volumen haben, was bildhaft erklärt, wie kleine Nekrosen (Absterben von einzelnen oder mehreren Zellen) und Thrombosen in der empfindlichen Drüse zustande kommen können – und wie eine Bauchspeicheldrüsenentzündung oftmals eigentlich entsteht.
6. Wie äußert sich eine Bauchspeicheldrüsenentzündung beim Hund?
Eine Pankreatitis tritt in zwei verschiedenen Formen auf – entweder akut oder chronisch.
Typische Symptome einer akuten Pankreatitis sind unter anderem:
Appetitlosigkeit
Erbrechen
Durchfall
Gewichtsverlust
Fieber
Schmerzen im Vorderbauch
Erschöpfung, Mattigkeit, Lustlosigkeit
Dehydration (Flüssigkeitsdefizit)
Lethargie
Gelbfärbung der Haut und Schleimhäute
Heller bis manchmal weißlichen Stuhlgang
Die Gebetsstellung kann ein Hinweis auf Bauchschmerzen sein.
Hunde mit Vorderbauchschmerzen nehmen in vielen Fällen die sogenannte „Gebetsstellung“ ein: Hierbei bleibt der Vorderkörper flach am Boden, während die Hinterbeine aufrecht stehen – ganz ähnlich der Haltung, wenn sich ein Hund streckt oder zum Spielen auffordert. Weitere Anzeichen für Bauchschmerzen können untypische Liegepositionen, steife Bewegungen, ein gebogener Rücken oder das bevorzugte Liegen auf kalten bzw. warmen Flächen sein.

7. Hinweise auf eine chronische Pankreatitis
Bei einer chronischen Pankreatitis können die Symptome weniger schwerwiegend, dafür aber dauerhafter sein, im Vergleich zur akuten Form. Zu den gängigen Symptomen gehören unter anderem:
Wiederkehrende Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust
Bauchschmerzen
Verdauungsprobleme wie Übelkeit und Erbrechen, Durchfall, Blähungen, Verstopfung
Fettiger oder öliger Stuhl
Nachlassende Kondition
Lethargische Phasen
Stumpfes Fell
Sollten Dir eins oder mehrere dieser Symptome bei Deinem Hund auffallen, empfehlen wir Dir, zeitnah in eine Tierarztpraxis zu gehen, um ihn auf eine mögliche Pankreatitis untersuchen zu lassen.
8. Wie kann man eine Pankreatitis beim Hund behandeln?
Eine Bauchspeicheldrüsenentzündung beim Hund kann sowohl klassisch als auch ganzheitlich behandelt werden. Die klassische Behandlung umfasst in der Regel die Verabreichung von schmerzlindernden Medikamenten, eine Flüssigkeitstherapie sowie eine spezielle Diät, um die Bauchspeicheldrüse zu entlasten.
Die Therapie kann folgende Maßnahmen umfassen:
Schonkost bzw. Spezialdiät (leicht verdaulich, fettreduziert)
Flüssigkeitstherapie zur Bekämpfung von Dehydration (Infusion)
Medikamente zur Schmerzlinderung und Entzündungshemmung, ggfs. auch gegen Erbrechen und Übelkeit
Antibiotika bei begleitenden Infektionen
Unterstützende Therapie durch die Zuführung von Pankreasenzymen zur Entlastung der Bauchspeicheldrüse
9. Was schützt vor Pankreatitis beim Hund?
Um Deinen Hund bestmöglich vor Pankreatitis zu schützen, empfehlen wir, selbst bei leichten Problemen mit der Bauchspeicheldrüse proaktiv zu handeln. Dafür haben wir hier erprobte Maßnahmen zusammengefasst.
Umstellung auf eine darmgesunde Ernährung
Sollte Dein Liebling Probleme mit der Bauchspeicheldrüse haben, empfehlen wir Dir, in Zukunft auf fettreiches Hundefutter zu verzichten. Um die Organe zu entlasten, solltest Du ein leicht verdauliches, fettarmes Futter wählen, das ausreichend Proteine und aufgeschlossene Kohlenhydrate enthält. Zudem benötigt der Körper eine gewisse Menge an Fett, um einem Mangel an Linolsäuren entgegenzuwirken und damit einhergehende Hauterkrankungen zu verhindern.
Kein Trockenfutter
Futter in Lebensmittelqualität
Hoher Fleisch/Fisch -Anteil
Wenig Kohlenhydrate
Geringer Fettanteil ( 5-8%)
Gute Fette und Öle ( Leinöl, Lachsöl)
Keine sinnlosen Füllstoffe
Frei von chemischen Zusatzstoffen
Frei von Gluten, Soja, Mais, …
schonende Zubereitung durch Kaltabfüllung
frei von Zucker und sonstigen Geschmacksverstärkern
frei von Konservierungsmitteln und Farbstoffen
frei von Lockstoffen und Füllstoffen
frei von Tiermehlen
frei von Pflanzen- und Getreidemehlen
10. Futter
Artgerechtes Nassfutter mit einem geringen Fettanteil ( 5-8%), sehr geringem Kohlehydratanteil, gute Fleischqualität ( ca.80-90%) , nicht mehr als 30% Innerreinen, FREI von Zusätzen, Aromastoffen, etc. Kein Mais oder Soja, kein Trockenfutter. Auch bei den Leckerlis auf die Qualität achten. Eine „Diät-Nahrung“ ist empfehlenswert. Hühnchen mit Reis, bei Entzündungen eher lactosefreien Hüttenkäse mit Reis. Sonst Proteinreiche Ernährung (Monoprotein). Etwas Leinöl.
Unbedingt: Aufbau der Darmflora ggfs Entgiftung mit Heilkohle o.ä.
Professionelle Ernährungsberatung
Empfehlung
Futterumstellungspaket mit Gockels Duett und Powerdarm
Gockels Duett besteht auch einem leichtverdaulichen Monoprotein (Huhn) und enthält nur 5% Fettanteil sowie 3% NfE
Hühnermuskelfleisch | 77 % |
Hühnerleber | 17 % |
Summe Fleisch | 94 % |
Kartoffel | 5 % |
Anteile < 1 % Zichorie (Inulin), Dill, Hagebutte, Kalzium, Salz | 1 % |
Summe | 100 % |
Muskelfleisch umfasst das Skelettfleisch sowie Herz- und Magenmuskel.
Oder
besteht auch einem leichtverdaulichen Monoprotein (Huhn) und enthält nur 5% Fettanteil sowie 2% NfE
Hühnermuskelfleisch | 78 % |
Hühnerleber | 7 % |
Hühnerhals | 7 % |
Summe Fleisch | 92 % |
Vollkornreis | 3 % |
Karotten | 3 % |
Apfel | 1 % |
Anteile < 1 % BrennnesselSalz | 1 % |
Summe | 100 % |
Muskelfleisch umfasst das Skelettfleisch sowie Herz- und Magenmuskel. Alle Werte gerundet.
11. Welche Zusätze sind empfehlenswert?
Um die Micronährstoffversorgung zu gewährleisten, ist darauf zu achten, dass es sich um ganzheitliche, bioverfügbare Produkte handelt. Also keine künstlichen oder chemisch synthetischen Zusatzstoffe.
Mindestgehalt an enzymatischer Aktivität je g
Lipase: 38.000 EP Units
Amylase: 32.500 EP Units
Protease: 2.100 EP Units
zur Stärkung der Darmflora
Fructooligosaccharide (prebiotisch) (ca. 100.000 mg/kg)
Mannanoligosaccharide (adhäsiv wirkend) (ca. 70.000 mg/kg)
Glucan-Polysaccharide (Immunstimulans) (ca. 110.000 mg/kg)
Enterococcus faecium (probiotisch)
Inulin (prebiotisch)
Ideales Aufbaupräparat
Bierhefe enthält die Vitamine B1, B2, B5, B6, PP, B12 und Biotin, viele Aminosäuren wie z.B. Isoleucin, Alanin, Glycin, Lysin, Tryptophan und Glutaminsäure, Mineralien (u.a. Phosphor, Kalcium, Kalium, Magnesium, Schwefel, Natrium, Eisen, Kupfer, Zink) sowie Cholin in natürlicher, gebundener Form.
Chlorella enthält die Vitamine A, B, B12 und Beta-Carotin, viele Aminosäuren wie z.B. Leucin, Threonin und Valin, ungesättigte essentielle Fettsäuren sowie Mineralien (u.a. Zink, Eisen) in natürlicher, gebundener Form.

Mariendistel, Artischocke, Goldrute, Echinacea, Kieselerde, Methylsulfonylmethan (MSM), Chlorella, Kapuzinerkresse unterstützen die Entgiftung und die Regeneration von Leber und Nieren.
Wie werden die Enzympräparate richtig angewendet?
Enzympräparate für Hunde sollen die fehlenden körpereigenen Enzyme ersetzen. Da die Verdauungsenzyme zum Aufschließen jeder Mahlzeit benötigt werden, sollten Sie sie auch jeder Mahlzeit zusetzen.
Von einer Mahlzeit ohne Enzymzusatz hat Ihr Hund wenig.
Die Enzyme gut unterzumischen soll gewährleisten, dass sie auch wirklich alle Nährstoffe in der Futterportion erreichen und aufschließen können. Deshalb wird häufig von Tabletten abgeraten oder empfohlen, Kapseln zu öffnen und den Inhalt über dem Futter zu verstreuen.
Allerdings werden die Enzyme dadurch stärker der Magensäure ausgesetzt, sodass magensaftresistente Kapseln durchaus Vorteile haben. Sollte Ihr Hund das Futter verweigern, wenn Sie der Mahlzeit Enzympulver zugesetzt haben, sind Tabletten und Kapseln eine Alternative.
Allgemein wird derzeit empfohlen, die Enzympräparate direkt vor der Fütterung mit dem Futter zu vermischen. Es ist nicht zwingend nötig, sie einwirken zu lassen.
Achte auf ein gesundes Körpergewicht bei Deinem Hund
Übergewicht kann das Risiko für eine Pankreatitis erhöhen. Daher ist es wichtig, Deinen Liebling in einem gesunden Gewichtsbereich zu halten. Darüber hinaus benötigt Dein Hund ausreichend Verdauungspausen, um Energie abzubauen und die Verdauung zu entlasten. Daher empfehlen wir, ihm abends keine zusätzlichen Mahlzeiten zu geben, da dies die Verdauung belasten kann.
Im Idealfall fütterst Du Deinen Hund einmal täglich (morgens/vormittags) oder maximal zweimal täglich, wobei er die letzte Mahlzeit vor 18 Uhr bekommen sollte. Wichtig ist auch, die Anzahl der Leckerlis zu begrenzen und diese in die tägliche Futterration mit einzuberechnen.
Füttere Deinem Hund keine Milchprodukte oder rohes Obst und Gemüse.
Der Körper Deines Hundes produziert so gut wie keine Laktase, um die Laktose in Milchprodukten zu verstoffwechseln. Rohes Obst enthält zu viel Zucker, während rohes Gemüse (wie z. B. Möhren) für Hunde schwer verdaulich ist. Um die Bauchspeicheldrüse und Verdauungsorgane Deines Lieblings nicht unnötig zu belasten, raten wir deshalb, diese Lebensmittel nicht bzw. nur in ganz geringen Mengen zu füttern.
Achte auf eine gute Trinkwasser-Qualität.
Stell Deinem Liebling immer frisches oder gefiltertes Wasser zur Verfügung und achte darauf, dass er nicht aus Pfützen o. Ä. trinkt, da eine bakterielle Überbelastung die Entstehung einer Pankreatitis begünstigen kann.
Geh mit Deinem Hund regelmäßig zum Tierarzt/zur Tierärztin.Durch regelmäßige tierärztliche Untersuchungen können potenzielle Risikofaktoren für die Gesundheit Deines Lieblings rechtzeitig erkannt werden. Das kann dabei helfen, Erkrankungen wie Pankreatitis zu verhindern oder frühzeitig zu behandeln.
Eine genaue Diagnose durch den Tierarzt ist wichtig, um den Hund zu retten. Langfristig geht es jedoch um die Ernährung des Tieres und eine dauerhafte Ernährungsumstellung. Denn Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse haben häufig mit der Ernährung zu tun.
Während die Entzündung völlig ausgeheilt werden kann, leiden Hunde ein Leben lang an einer Insuffizienz der Bauchspeicheldrüse.
Nach einer überstandenen Entzündung besteht die Möglichkeit, dass Ihr Vierbeiner über kurz oder lang wieder ganz normal fressen kann und sich eine Diät erübrigt.
Bei der Schwäche ist meist eine sehr langwierige Einstellung erforderlich. Dabei kann es passieren, dass Ihr Hund viele Zutaten im Futter nicht mehr so gut verträgt wie vor der Erkrankung.
Ich wünsche Dir und Deinem Liebling alles Gute
TIPP: Nutzen sie unseren Rückrufservice für eine kostenlose Beratung
Weitere Informationen und kostenfreie, fachliche Beratung erhalten Sie gerne.
Bitte um eine kurze Nachricht über unsere Homepage www.docavital.com oder 0043 676 5201456
Mit dem Gutscheincode BLOG10 erhalten Sie 10% Neukundenrabatt!
Herzlichst Ihr
Olivier Rainer Ph.D.
Orthomolekular Mediziner, Ernährungswissenschaftler,
Natur-THP, Dipl. Ernährungsberater für Mensch und Tier,
Dipl. Human- und Tierenergetik,
Die Informationen auf diesen Seiten sind allgemeine Hinweise, die mit Unterstützung von Experten nach bestem Wissen und Gewissen sorgfältig recherchiert und aufgearbeitet worden sind. Die Autoren und die Seitenbetreiber übernehmen keine Verantwortung auf Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden sind.
Quellen/Fotos: DNA-die neuen Akademien, Linus Pauling Academy, ww.drhoelter.de/tierarzt/tierkrankheiten/pankreasinsuffizienz-beim-hund.html, ww.dasgesundetier.de/magazin/artikel/pankreatitis-beim-hund,
Bradley EL. A clinically based classification system for acute pancreatitis. Arch Surg 1993; 128: 586–590
Newman SJ, Steiner JM, Woosley K et al. Histologic assessmenand grading of the exocrine pancreas in the dog. J Vet Diagn
2006; 18: 115–118, Spillmann T. Pancreatitis: Etiology and pathophysiology. In: Ettinger SJ, Feldman EC, Coté E, eds. Textbook of Veterinary
Internal Medicine. St. Louis: Elsevier; 2017: 1681–1682 Mansfield C. Acute pancreatitis in dogs: advances in under-standing, diagnostics, and treatment. Top Companion Anim Med 2012; 27: 123–132 Watson PJ, Roulois AJ, Scase T et al. Characterization of chronic pancreatitis in English Cocker Spaniels. J Vet Intern Med 2011; 25: 797–804





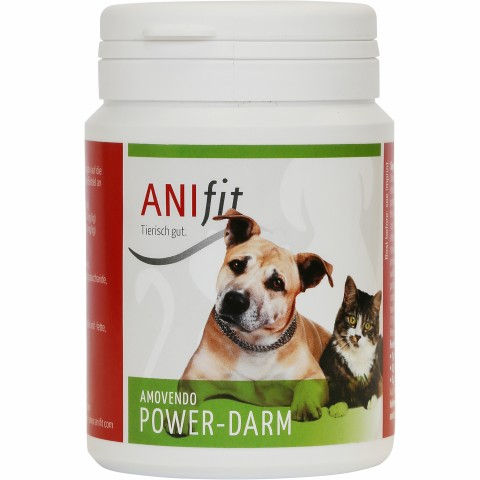




Comentarios